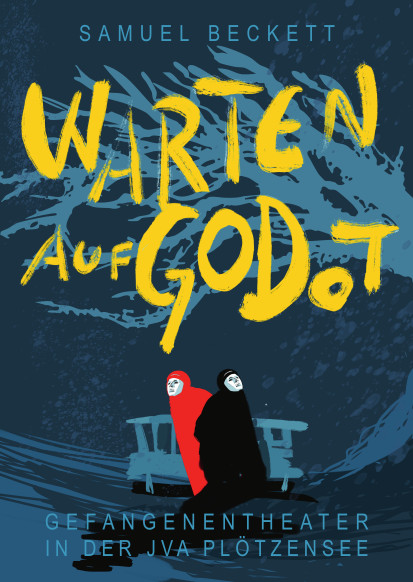Schattenboxen – Neue Bühne Senftenberg Rezension
Ich komme auf einem düsteren Bahnhof an. Im Bahnhofsgebäude rechts und links oben, riesige, bräunlich verblichene Gemälde. Das eine zeigt den Tierpark Senftenberg, das andere die moderne Stadtansicht mit Blick auf einen See. An den Wänden, über den jetzt toten Schaltern, Bilder, auf denen diverse Symbole zu sehen sind, darunter zu lesen: Gepäckaufbewahrung, Internationale Fahrausweise, Reservierung von Schlafwagenkarten, Service-Büro, Mitropa, jetzt alles leer, die Schalter zugenagelt mit dunkelbraun bemalten Holzplatten. Ein Fahrkartenautomat steht einsam in einer Ecke. Draußen leere Straßen, die schnurgerade irgendwohin führen, verlassene und halbverlassene Häuser in grauem Putz ziehen sich die Straße entlang, nirgends ein Lebenszeichen. Dabei ist das Bahnhofsgebäude durchaus stattlich, es besitzt sogar ein zweites Stockwerk, in dem ein beleuchtetes Fenster einen Bahnbeamten an einem Schreibtisch zeigt.
Aber auf dem Bahnhofsvorplatz eine Litfasssäule und darauf groß das Plakat des Theaters, zu dessen Premiere ich unterwegs bin. Schattenboxen, ein Stück von Dennis Foon, eines geistigen Bruders von Volker Ludwig, in Detroit, Michigan geboren und seit 1973 in Kanada lebend. Er gründete 1974 ein Kindertheater und schrieb vielfach ausgezeichnete Drehbücher und Theaterstücke. Schattenboxen handelt von den Schwierigkeiten jugendlicher Beziehungsgestaltung in den Zeiten zunehmender Kälte.
Es ist die deutschsprachige Erstaufführung, die mich in das Theater der Stadt gelockt hat, das sich, 46 gegründet, ab 1990 Neue Bühne Senftenberg nennt und als ein Bauhaus-Schuhkarton, angeklebt an eine Schule, tief in einer Plattenbausiedlung steckt. Doch sein Spiel ist über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt geworden, 2005 wurde das Theater von der Zeitschrift Theater heute zusammen mit dem Deutschen Theater Berlin, den Münchner Kammerspielen und dem Deutschen Schauspielhaus Hamburg zum Theater des Jahres gewählt. Das Gebäude nimmt innen die Farbe des Bahnhofs wieder auf, riesige dunkelbraune Wände, ohne jeden Schmuck, das Bühnenbild eine Betonmauernlandschaft, mit unverständlichen Sprüchen besprüht, typische Aufenthaltsorte herumlungernder Jugendlicher, denen man die Jugendzentren geschlossen und die Zukunftsperspektiven genommen hat.
Der Hauptdarsteller tritt auf und zeigt über Minuten ein Gesicht eindrucksvoller Leere. Verpanzerung. Selbsthass und Selbstabwertung bestimmen den ersten Teil, und das Thema aus „Heimweh“ (Premiere 30.1.10), des vorigen Stückes, in dem ein Jugendlicher beschließt Selbstmord zu machen, wird wieder aufgenommen. Die Geschichte entfaltet sich zwischen vier Jugendlichen, deren Gewalttätigkeit sich je stärker entwickelt, je verzweifelter ihre Verwundungen durch ihre Eltern sichtbar werden. Die jungen Schauspieler spielen glaubwürdig und überzeugend, sind Typen, die Wirklichkeit abbilden, die Komposition ist einfach. Sprache und Gestik der Jugendlichen gut getroffen.
Das Highlight ist der Kunstgriff, dass die Eltern in Form weißer Schattenrisse im Hintergrund auftauchen, sobald sich Krisen hochschaukeln und dort pantomimisch, die Erinnerungsflashbacks der Jugendlichen zeigen, die mit Drohungen, Krachs, Streit, Verzweiflung aus dem wohl gehüteten Inneren des Privatlebens, den Protagonisten zwischen ihre eigenen Dialoge funken. Dadurch wird sichtbar, wie schwer wir den Mustern der Erwachsenen entrinnen können und wie sehr wir von diesen Mustern bestimmt werden. Auch zeigt sich, als öffne sich ein Fenster, das ganze Ausmaß der in den Abgrund gestürzten Schichten der DDR-Bevölkerung zwischen Hartz IV und Alkohol, Brutalität und Verlassenheit.
Sara schafft es, sich von ihrem Macho zu trennen, bleibt also nicht abhängig, klein und hilflos, es gibt kein Happy End für Bob, man hat etwas verstanden, zurück bleibt Wut über die Verhältnisse, die Leere hat sich gefüllt, die Frage stellt sich: Was tun?
Auf dem Rückweg hat hell erleuchtet ein REWE noch auf, ich parke mein Fahrrad. Vor dem Laden eine Clique Jugendlicher mit Bierflaschen in den Händen, grölend. An der Kasse stehen drei davon vor mir, sie lachen, sie kloppen Sprüche, sie sind wie leibhaftig dem Theater entsprungen. Eine Frau sagt zur Kassiererin: Und das soll unsere Jugend sein?? Unsere Zukunft??? Die junge Kassiererin: Ich war nie so, es sind nicht alle so, sie lacht. Die Jugendlichen hatten niemandem etwas getan.
Dennis Foon sagt über Jugendliche: sie versuchen, in ihren Möglichkeiten, Menschen zu sein, da aber keiner von ihnen wirklich eine Ahnung hat, wie man das tun soll, vermasseln sie es. Sie sind von sich selbst getrennt, von allem, was sie umgibt, weil sie gelehrt wurden, als Teil des „Mann-Seins,“ aggressiv zu sein und unverwundbar. Teil dieser Unverbundenheit ist ihre reduzierte Sprache, mit der sie andere herabzusetzen und Kontrolle über sich und andere zu gewinnen versuchen. Sie sprechen in einem Slang, den sie als Waffe benutzen in ihrem ungleichen Kampf. Gelungene Aufführung, unbedingt sehenswert!