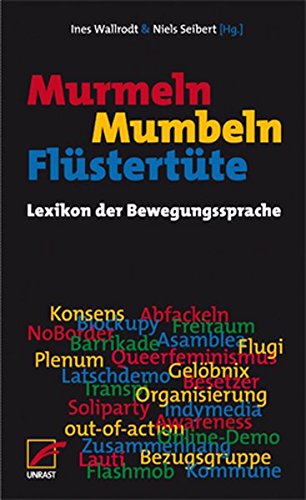Der lange Schatten der Täter – Buchrezension
Nachdem Alexandra Senfft viel über ihre Familie nachgedacht, aufgearbeitet und geschrieben hat, hat sie sich nun auf die Suche gemacht und andere getroffen. Menschen, die in irgendeiner Weise ebenfalls etwas mit Nazitätern und ihren Schatten zu tun hatten. Sie ist die Enkelin von Hanns Ludin, der seine braune Karriere bei der SA begonnen hatte und im Krieg zum Gesandten Hitlers in der Slowakei aufgestiegen war.
Ergebnis ihrer Spurensuche sind interessante Porträts und Interviews, die im Laufe vieler Begegnungen und Gespräche entstanden sind. Dabei traf sie auch Nachkommen von Naziopfern – in ihrem Buch »Der lange Schatten der Täter« beschreibt sie ihre Scheu, ihre Scham, versucht sich in Versöhnung.
Eingangs schildert sie einen Naziprozess gegen einen uralten Mann: Schon am ersten Tag wird der Termin nach zehn Minuten verschoben, alle Zeugen, von weither angereist, müssen wieder gehen und auf den nächsten Termin Monate später warten. Unerträgliche Verschleppungstaktik; trotzdem wichtig, dass dieser Prozess stattfindet, finden die Zeugen, die aus Israel angereist sind.
Da mussten sie eben zuschlagen, es ging nicht anders
Was das Buch von anderen dieser Richtung unterscheidet, ist die Tatsache, dass es sich vor allem mit der psychodynamischen Wirkung der Nazitäterschaft innerhalb der Familien befasst. Dezidiert beschreibt Senfft, was die Mischung aus Schweigen, Mauern und gefühlskalter Rechtfertigung unvorstellbarer Morde in den Seelen der Nachkommen anrichtet – und dass die »Nazis nicht nur ihre Opfer ein Leben lang leiden ließen, sondern auch ihre Kinder« (S. 60). Dies relativiert nicht ihre Taten. Im Gegenteil, es ist ein wichtiger Mosaikstein der Faschismusforschung: Treusorgende Väter waren sie nur zum Schein, im Inneren der Familie waren ihnen ihre Kinder beinahe ebensolche Feinde wie einst ihre Gegner. Unfassbar blieb ihnen, dass sie, vor denen man einst gezittert hatte, sich bei den eigenen Kindern nicht durchsetzen konnten. Da mussten sie eben zuschlagen; ging nicht anders.
Leben erschwert
Die Nachkommen erzählen alle, dass sie an einer Wand abprallten, einer Wand aus Strafen, Schuld und Vorwürfen, einer Wand aus Fremdbeschuldigung und Selbstmitleid, einer Wand, die sie sich nicht erklären konnten und die ihnen den Weg zu ihren Eltern verbaut, den zum Leben erschwert hat.
Ich bin ein Nazi-Enkel
Ein Buch des Staunens und der Wut. Eine eindeutige Stellungnahme gegen die Naziverbrecher in der eigenen Familie. Stefan Ochaba zum Beispiel sagt: »Ich bin kein Kriegsenkel, ich bin ein Nazi-Enkel«, und wendet sich damit gegen die Moderichtung, alle eigenen Unzulänglichkeiten auf die Kriegstraumata der Eltern zurückzuführen und als »Kriegsenkel« zum Teil unkritisch mit Vertriebenenverbänden zusammenzuarbeiten.
Athmosphäre der Feindseligkeit, des beredten Schweigens und lauernder Fremdbeschuldigung
Das Buch kann als exemplarisch gelten, da es in Deutschland von Nazitätern nur so wimmelte, die sich in den 1950er Jahren sämtlich als harmlos-unwissende Mitläufer eingestuft haben. Um diese Lüge und Selbsttäuschung aufrechterhalten zu können, schufen sie eine Atmosphäre der Feindseligkeit, des beredten Schweigens und lauernder Fremdbeschuldigung. Sie ergingen sich in immer gleich klagenden Flucht- , Hunger-, Vergewaltigungsgeschichten, die auf Täter-Opfer-Umkehr hinausliefen. Damit verbunden waren stereotype Abwehr, redundantes Gefasel von »Kriegszeiten« als Abenteuerroman, unter dem der Faschismus verborgen wurde. Nichts erinnern, nichts hören, nichts sehen: So wuchsen die Nachkommen der ersten Generation nicht nur in Un-, Halb- und Lückenwissen auf, sondern in einer Atmosphäre von Lüge, Kälte und Mittäterschaft. Wenn der Faschismus überhaupt privat thematisiert wurde, so schloss sich immer die eigene Familie aus, denn da hatte es nur gute Nazis, allenfalls verirrte Mitläufer gegeben. Wo die Täterschaft auf der Hand lag, sprach man von Idealismus und Selbstlosigkeit, und der ununterbrochenen großen Sorge, die dem Familienoberhaupt wegen seiner großen Sippe oblegen hatte. Da konnten sich die Kinder also noch damit abplagen, dass es ihretwegen geschehen war. Die Haltung, dass keiner eine andere Wahl gehabt und es daher eine persönliche Schuld nicht gegeben hätte, wurde von allen Porträtierten als unerträglich empfunden.
Emotionale Säureattacken
Alexandra Senffts Buch wirkt wie eine Reise durch das Erinnern. Es schildert Begegnungen mit Holocaust-Überlebenden, die zu Freunden geworden sind, es zeigt Wege auf, mit dem Erbe der Nazis aufdeckend umzugehen und es als Auftrag zu verstehen, ähnliche Entwicklungen für alle Zeiten zu verhindern. Beispiel: Quentin van Veer, Nachkomme von Ludendorff-Rechten, die nach 1945 weiterhin Naziideologie vertreten. Er schreibt, dass er sich durch seine Eltern heute zwar nicht mehr »schuldig« fühlt, aber »besudelt und beschämt«, auch erlitt er Grausamkeit: Seine Mutter machte mit einer Hand »helfende Gesten«, mit der anderen war sie zu emotionalen Säureattacken fähig.
Das Ringen der Aufdecker gegen die Abwehr
Als Kind fühlte sich Quentin wie ein dressierter Affe. Als er sein Studium erfolgreich beendet hatte, empfing ihn die Mutter mit den Worten: »Mit deinem Doktor kannst du gerade mal Hotelzimmer aufräumen!« Niklas Frank erzählt, seine Tochter habe einmal gesagt, dass sie nur durch die Aufdeckungsbemühungen des Vaters »frei und ehrlich aufwachsen konnte«.
Senffts Porträts gehen immer wieder durch den Filter ihrer eigenen Erfahrungen, sie fühlt sich den Menschen verwandt, die sie trifft, erzählt von sich und ihrem Erleben. Das Buch beschreibt das Ringen der »Aufdecker« gegen massive Abwehr, Drohungen und Beschuldigungen der Verwandten, ihre neuen Freunde in den Reihen der Antifaschisten und ihre innerliche Gesundung von den autoritär-unterdrückerischen Praktiken ihrer Nazieltern.
Nachkommen von Nazi-Tätern stellen sich ihrer Familiengeschichte: